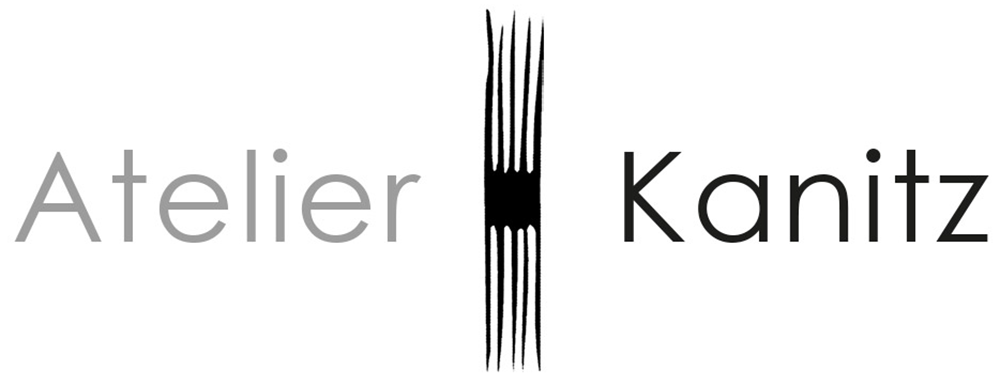Laudatio zur Eröffnung der Ausstellung „Refugium” von Jens Kanitz
Von Prof. Dr. Thomas Thiessen
Schloss Rheinsberg, Februar 2011
Was ich an einem ausstellenden Künstler fast am meisten bewundere, das ist sein Mut. Sein Mut sich zu zeigen, sich zu öffnen, sich diskutabel zu machen, unter Umständen aber auch besonders angreifbar. Natürlich können wir jedes Werk immer von der Person des Künstlers zu abstrahieren versuchen. Aber das gelingt uns in der Regel kaum. Wir schielen meist auf die Person des Künstlers. Wir fragen doch ganz selten „Was sagt uns dieses Werk?“, wir fragen meist „Was will uns wohl der Künstler damit sagen?“
Was wir also sehen in der Ausstellung Refugium, das ist der unmittelbare Ausdruck des Menschen Jens Kanitz. Und die Kunstinteressenten, die seine Arbeiten anschauen, versuchen, durch das Werk des Künstlers hindurch bis in die Tiefe seiner Persönlichkeit zu schauen, möglichst mit Röntgenblick. Dieser Vorgang ist extrem öffentlich.
Darum ist ja auch der Titel der Ausstellung erst einmal widersprüchlich. Refugium. Ein Refugium ist nichts anderes als der Zufluchtsort eines Individuums in bedrohlichen Situationen. „Refugere“ bedeutet „zurückweichen“, sich in den innersten Zirkel der Festung zurückziehen, eine stämmige Tür zuschlagen, den Riesenschlüssel fünf mal umdrehen und ausharren, bis die Gefahr vorüber ist. Nach dem Motto: „Guck bitte nicht hin, gehe vorüber und verschone mich mit Deiner Aufmerksamkeit.“ Noch privater als Refugium geht also eigentlich nicht. Das englische „refugee“ geht sogar noch weiter: es bedeutet Flüchtling. „Refugere“ ist also das glatte Gegenteil von der individuellen Veröffentlichung, die wir in der Ausstellung Refugium erfahren dürfen. Und dennoch empfinden wir diese Ausstellungssituation gar nicht als paradox. Im Gegenteil: Die ausgestellten Werke, vor ihrem Publikum, an ihrem Ort, in dieser Stadt, das hat nichts Widersprüchliches, das hat im Gegenteil etwas sehr Glaubwürdiges.
Wenn wir uns die gezeigten Werke ansehen, dann dominiert der Werkstoff Holz. Es ist sicher verkürzt, Jens Kanitz als Holzkünstler zu bezeichnen. Aber er hat immer viel mit Holz gearbeitet. In seinem „früheren“ Leben hat Jens Kanitz sogar eine Ausbildung zum Forstwirt absolviert. Seine Transfloration in dem Gutspark des kleinen Ortes Netzeband war ein ganz erstaunliches Holzprojekt und hat sich tief in mein Gedächtnis eingelagert.
Holz ist ein sehr warmer Werkstoff, ein organischer, natürlicher Werkstoff. Holz hat etwas Ruhendes, Schützendes, Wärmendes. Mit einem Refugium aus Metall oder Beton könnten wir uns sicher nicht so richtig anfreunden, obwohl es doch viel beständiger und unzerstörbarer ist als Holz. Holz ermöglicht uns eine bestimmte Wahrnehmung von Nähe, von natürlicher Aufgehobenheit, es wirkt viel leichter als andere Materialien. Wurzeln sind aus Holz. Holz ist ein sehr elementares Material, leicht veränderbar und dabei auch außerordentlich widerstandsfähig. Wer weiß, wie viele Häuser alleine in Rheinsberg so nahe am See auf Holzpfählen ruhen. Der Titel der Ausstellung Refugium und der vorherrschende Werkstoff passen also auf eine seltsame Art und Weise zueinander.
Es mag dabei erwähnenswert sein, dass Jens Kanitz seine Kindheit in Rheinsberg verbracht hat und nicht nur diese Stadt, sondern auch die waldreiche Umgebung als Refugium erlebt hat. Jens Kanitz war als Kind ein echter Insektenspezialist und hat sich leidenschaftlich für Schmetterlinge interessiert. Da haben wir es wieder: Irgendwann entpuppt sich ein Schmetterling aus seinem Refugium und wird auffällig wie ein Künstler. Die Nähe zur Natur impliziert eben auch eine Nähe zum Holz. Wir finden also eine im wahrsten Sinne natürliche Verbindung zwischen dem naturnahen biografischen Epizentrum des Künstlers, dem gewachsenen, organischen Werkstoff Holz und dem Refugium in seiner Wortbedeutung. Von da ist es dann kein großer Schritt mehr, die Abstraktion von Refugium als Gegenstand für den künstlerischen Ausdruck zu entdecken.
Ich persönlich entdecke in den gezeigten Skulpturen und Bildern drei Ausdrucksebenen als Variationen zum Thema Refugium. Ich sehe als erste Ausdrucksebene das Refugium als Ort.
Refugium als Ort mögen die hier gezeigten Häuser sein. Wir sehen sie tief, nahezu überdimensional verwurzelt. Wir sehen das Haus als archaischen, verkapselten und immobilen Schutzraum. Warum spricht uns das so an?
Wir leben in Zeiten der Multioptionalität und der wachsenden Beliebigkeit. Wir leben in Zeiten, in denen wir zur inneren und äußeren Mobilität gezwungen sind. Wir leben in Zeiten, in denen sich Familienstrukturen auflösen und 60% aller Kinder in Patchworksituationen aufwachsen. Wir leben in Zeiten, in denen wir uns vielleicht mehr als frühere Generationen damit abmühen müssen, einen eigenen Standpunkt im Leben und eine Mitte zu finden. Das Haus spricht uns deshalb vielleicht in besonderem Maße in unseren Sehnsüchten nach Verlangsamung und Angekommensein an. Zugleich aber werden die Hausskulpturen von Jens Kanitz über die besondere Technik der Brandbearbeitung der Wurzeln nicht nur stabilisiert. Etwas macht das Refugium Haus aus der eigenen Substanz heraus brüchig und angreifbar. Eben nicht von außen. Und in der Skulptur DAS BÖSE IN MIR hat diese Eruption aus der eigenen Tiefe des Refugiums seine Zerstörungskraft bereits entfaltet.
Ohne diese Kraft scheint es kein Refugium und keinen Ausgleich zu geben. Das Schützende und das Zerstörende sind die zwei Seiten einer Medaille. Das ist ein uraltes Motiv.
Ich sehe eine zweite Ausdrucksebene des Refugiums in dieser Ausstellung: Refugium als Symbol. Die drei auffälligsten Skulpturen hierbei sind sicherlich das Trio American Dream, American Fight, American Fire. Sie konfrontieren uns als Symbol des Refugiums mit einer nationalen oder politischen Identität, sind durchaus aber auch Symbole für spezifische Identitätsbrüche. Wir sehen in AMERICAN DREAM eine androgyne Taucherfigur in schlanker und graziler Effizienz, eher weiblich und in müheloser Raumnahme: Die Abstraktion des Amerikanischen Traums, eines hoffnungsvollen politischen Gebildes, das Unglaubliches geleistet hat und bis heute zu leisten imstande ist. Daneben die verzweifelt angestrengte Haltung des AMERICAN FIGHT mit einem so überhöhten Selbstanspruch, dass die Leichtigkeit einem verkrampften Kraftakt weicht. Beide Skulpturen hantieren an einem Riesenpfropfen, man würde ihnen wünschen, sie schaffen es nicht ihn zu ziehen, denn dann verlören Sie ihr eigenes Element. Dritte Skulptur im Bunde ist das AMERICAN FIRE, ein verwüstetes, selbstverlorenes Gebilde, voll elementarer Kraft. Es liegt nahe, in diesem Trio auch aktuelle Themen verarbeitet zu sehen: Den hoffnungsfrohen, nahezu euphorisierenden Beginn der Obama-Administration und das, was die Teaparty davon übrig gelassen hat. Insofern provoziert diese Bedeutungsebene des Refugiums als Symbol durchaus auch eine tagesaktuelle, mitunter plakative Diskussion. Aber auch diese Bedeutungsebene des Symbols arbeitet mit einem Haus, wir sehen das HAUS EUROPA, und auch dieses Werk verleitet zur Diskussion, gerade im Vergleich zum American Trio. Sind wir in unserem europäischen Refugium tatsächlich so aufgehoben, in Relation zur Amerikanischen Idee?
Ich sehe eine dritte Bedeutungsebene: Refugium als Aufhebung der Zeit.
Für diese Bedeutungsebene mögen die beiden Skulpturen ASTTRÄGER und LOVER stehen. Bei beiden Figuren ist interessant zu sehen, wie mit dem organischen Werkstoff Holz ein dermaßen roboterhafter und futuristischer Gestus geschaffen werden kann. Der Astträger ist schwer beladen, aber absolut folgerichtig in seinen technokratischen Abläufen wie eine Lastmaschine. Und dennoch hat er eine archaische Dimension. Man würde ihm abnehmen, dass er mit Elektronik vollgestopft und digital gesteuert wird. Man würde ihm aber auch glauben, dass er auf ursprünglichste Weise uralte Lasten trägt. Auch der Lover wirkt zwar futuristisch und technokratisch, könnte zugleich aber auch als eine zigtausend Jahre alte mythische Figur durchgehen. Oder die DROHNE: Ihre Haltung ist zeitlos, zugleich ist die Drohne der Prototyp der modernen technologiegestützten Erkundung.
Und dann nehmen wir im Augenwinkel immer auch eine Figur wahr, die diese drei Dimensionen des Refugiums Ort, Symbol und Aufhebung der Zeit in sich kulminiert und die das Werk von Jens Kanitz seit geraumer Zeit begleitet: Ma'at.
Ma'at ist eine Göttin der ägyptischen Mythologie. Sie bezeichnet die moralische und zugleich die kosmologische Weltordnung. Nur dank der Ma'at sind wir nett zueinander, nur dank der Ma'at geht die Sonne auf und wieder unter. Ma'at bezeichnet also nicht nur das Ideal der Welt, sondern ihren harmonischen Ist-Zustand. Durch unser menschliches Verhalten kann die Balance aber aus dem Gleichgewicht geraten. Dann kommt Chaos über die Erde. Diese Zerstörung gehört zur mythischen Weltordnung dazu. Aber vor allem geht es darum, dass die Ma'at die Oberhand behält.
Wenn wir die Ma'at von Jens Kanitz nicht als mythisches, sondern als psychologisches Konzept definieren, dann erschließt sich das Bild der Ma ́at auf eine interessante Weise. Wir sehen sie im Zentrum der Bilder von Jens Kanitz, wie im Relief PERIPHERIE. Dort schafft sie inmitten der verwirrenden Strukturen ein Kraftzentrum, von dessen Schwerkraft diese vielen seltsamen und verrückten bis wahnsinnigen kleinen Figürchen eingefangen und in einer selbstberuhigenden, liebevollen Umlaufbahn gehalten werden. Wer von uns kennt sie nicht, diese kleinen Wahnsinnigkeiten in unserer Persönlichkeit, die wir möglichst nicht auf uns selbst oder die Mitmenschen loslassen sollten.
Auch in dieser psychologisierenden Deutung der Ma ́at formuliert sich ein Begriff des Refugiums als ein Zufluchtsort. Zuflucht wohin? Erinnern wir uns: Ma'at ist eine Göttin. Nennen wir es doch: Zuflucht in die Transzendenz. Der Glaube als Refugium. So deute ich für mich die Ma'at.
Ich möchte zum Abschluss auf die Skulptur eingehen, die dieser Ausstellung ihren Namen gibt: REFUGIUM. Ich glaube, dieses Werk hätte keinen besseren Namen verdient. Es ist, als ob sich der Begriff, das Material und die Form ganz natürlich gefunden haben. Refugium zeichnet sich dadurch aus, dass es nach innen verdichtet und gesammelt ist und nach außen abgegrenzt. Wir sehen einen Strukturreichtum und eine Artenvielfalt wie in einem Korallenriff, ein reichhaltiges und etwas chaotisches Hin und Her mit undurchschaubaren Ordnungskriterien. Und dennoch wirkt die Skulptur ruhig und mittig. Ich glaube, wir alle dürfen diese Skulptur ein wenig um ihre ebenso kompakte wie zugleich verspielte Ausstrahlung beneiden. Vielleicht dürfen wir ihr sogar ein wenig nacheifern. In unserer Persönlichkeit. In unserem Lebensentwurf. In unserem Miteinander. In unserer Liebe. Vielfältig, verschlungen, nicht recht nachvollziehbar und trotzdem wohl sortiert und zumindest von außen kaum angreifbar. Doch diese Skulptur hat eine Botschaft ganz für sich selbst und auch für uns alle. Wir sollten Jens Kanitz danken, dass er dieses Refugium für uns geschaffen hat.
Zum Werk von Jens Kanitz
Ingrid L. Ernst
Oktober 2005
Der Produktionsprozess eines Künstlers ist nicht unbedingt aus den Stationen seiner Biographie zu erschließen. Meistens entsteht der Durchbruch in unkonventionelle Formen erst durch die Arbeit und wird letztlich nie richtig erkennbar, nie richtig transparent und ist auch für den Künstler selber nicht durchschaubar. Sein innerer Denkraum ist verborgen, eingeschlossen von einem besonderen Bezug zur Wirklichkeit. In der Arbeit von Jens Kanitz ist dieser Bezug ein wichtiges, kaum zu öffnendes Element. Die Hinwendung zum landschaftlichen Raum, das Entdecken von darin vorgefundenem Material und die Beobachtung von Werden und Verändern sind Bestandteile im Denkraum von Kanitz. Aus diesem in heutiger Zeit außergewöhnlichen Bezug entstehen die Ideen künstlerisch-ästhetischer Umsetzung, darin steckt sein Selbstbezug. Kanitz ist Schöpfer aus dem vorgefundenen gefundenen Material seiner Umgebung. Ein Künstler, der die feinstofflichen Angebote der Natur und ihre Erfindungen wahrnimmt, sie zu weiteren Transformationen veranlasst und bearbeitet.
Über den LAUSCHER, jene Bronzefigur auf dem Gehweg zwischen den Neuruppiner Kliniken, ist sicher noch am ehesten etwas über den Selbstbezug seiner künstlerischen Wahrnehmung zu erfahren. Der Lauscher ist ein mannshoher unbekleideter Körper aus Bronze mit leicht ausgebreiteten Armen, das Innere der Handflächen horizontal zum Körper nach unten gewendet, gleichsam als würden sie Luft gegen den Boden drücken und weitertreiben in einen unsichtbaren Raum. Es ist ein nackter naturalistischer Körper mit beinah afrikanischen Proportionen, der sich im Gehen befindet, in einem Moment von Innehalten, der rechte vordere Fuß verlagert bereits das Gewicht zu einer weiteren Bewegung in die eingenommene Richtung. Ob mit geschlossenen Augen oder mit offenen, das ist nicht ganz klar, zu sehen ist, wie sich der Körper intensiviert, wie Hören und Sehen sich in allen Gliedern formuliert. Erstaunlich ist die Art der Aufstellung direkt auf seinen ungeschützten Fußsohlen mitten auf dem gepflasterten und verkehrsreichen Gehweg, augenfällig in Bezug gesetzt zu den beiden eisernen Pfosten rechts und links, die – würde er sich nach vorne bewegen – als nächstes von ihm durchschritten würden. Gleichwohl wie ein performatives Ereignis stellt sich die Figur des Lauschers jedem neuen Besucher in den Weg. In ihrer besonderen Gegenwärtigkeit und ihrem provozierenden Bezug zu den Klinikgebäuden wird sie erfahrbar als ein auf den Erzählwert des Ortes verweisendes Kunstwerk. Darum ist die Figur des Lauschers auch nicht abbildbar sondern muss vor Ort gesehen und erlebt werden.
Gerahmt unter Glas in klassischen Bildformaten befinden sich die LIBELLEN.
Das sind mit Eisenchlorid und mit einem sehr feinen Pinsel gezeichnete spinnengleiche Formen auf Papier. Sie erwecken den Eindruck von Höhlenzeichnungen aus einer frühzeitlichen Kulturepoche oder von übergroßen Insekten, an deren weiblichen, dünnen Körpern sich Arme und Beine gleichsam als Fäden bewegen und verweben. Nebeneinander gehängt wirken sie wie Zeichen einer geheimen Priesterschrift auf einem Tableau, das von der Konstruktion der Gebeine und Gelenke erzählt, von Momenten ihrer Bewegung und Gliederung. Die Libellen sind sorgfältig gebaute Naturstudien von Wesen, die es so eigentlich gar nicht gibt und die man doch schon einmal gesehen hat. Sie sind Abkömmlinge eines täglichen Tuns von Kanitz, des Zeichnens und des zeichnerischen Denkens. Auch im Werk von Kanitz ist Zeichnen eine permanente Funktion, um sich Ideen vor Augen zu führen, Formen weiter zu treiben, Wege zu lokalisieren und Bauweisen zu durchdenken. Neben dem riesigen mit einer einzigen Platte abgedeckten Billardtisch in seinem Atelier stapeln sich die Skizzenund Notizbücher, in denen sich die Gedankenexperimente zu möglichen Prozessen verbergen. Sie stellen einen zeichnerischen Kosmos von tagebuchartigen Stenogrammen, Kompositionsskizzen, Bildhauerzeichnungen und Abbreviaturen dar, die sich als Bestandteile seines Sehens und Denkens ausweisen.
In der Mitte seines Ateliers in der Industriehalle an der Heinrich-Rau-Straße in Neuruppin sind sie aufgestellt, die langen mageren STÄBE, mehrere auf einer Fläche angeordnet, kalkweiß, mit leichten Biegungen in der Vertikalen, einer kugelförmigen, manchmal auch gelben Verdickung in der Mitte, an deren Ende sich das Holz spreizt, vielfach aufspaltet, gleichsam zerlegt in Fasern in die Luft ausläuft. Sie wirken wie filigrane Objekte eines magischen Rituals oder wie auf Stäbe extrem reduzierte Bäume, Symbole für Wachstum. Dicht an dicht stehend markieren sie sichtbar einen fremden Raum im Raum, der in seiner Bewegungslosigkeit und Stille zwischen allen anderen Dingen im Atelier undurchdringlich erscheint und sich wie ein Ort eigner Zeit ausnimmt.
Orte muss ich durchlaufen, sagt Kanitz, am Ort muss ich sehen können, wo ich hin will. Wenn ich mit meinem Gebrannten in den Raum gehe, ist der Raum still und bleibt still. Nehme ich eine Farbe dazu, erzeuge ich Klang. Jede Farbe hat ihr Interesse, und manchmal werden dadurch regelrechte Kettenreaktionen ausgelöst, mit denen ich dann umzugehen habe. Kanitz ist ein Künstler mit ausgeprägtem Ortsbezug, der erst über das, was er am Ort vorfindet, hinausgeht, wenn er ihn ausführlich wahrgenommen hat.
Die SCHÜTTUNG ist aus einem solchen Ortsbezug entstanden. Das ist eine temporäre Installation aus der Zeit, als Kanitz noch im Gutspark Netzeband sein Forschungslabor unter freiem Himmel errichtet hatte. Damals erschien der Brennplatz in direkter Nähe zu dem mit Schilf eingewachsenen Weiher und den knorrigen Eichen wie eine mittelalterliche Versuchsanordnung. Hier entstanden die elementaren Baumskulpturen, die durch komplizierte Brennvorgänge, die Einwirkung von Feuer, in neue Formen überführt wurden. In unmittelbarer Nähe erhoben sich die Hügel der Schüttung aus dem mit Blattwerk überwucherten Erdboden. Die Schüttung wurde gebildet aus kegelförmigen Aufhäufungen von Abfällen, die aus der Brennung hervorgegangen sind. Der Berg in der Mitte bestand aus Schalen, Absplitterungen, aus Verschnitt, Schnipseln von Holz, die aus den vorbereitenden Behandlungen der Baumstämme vor dem Brennen entstanden sind, kreisförmig umgeben von sechs kleineren Hügeln aus Material, das aus dem Brennen von Holz entstanden ist. Asche, winzige Stückchen von Holzkohle, verkohlte Partikel wurden nach jedem Brennvorgang auf die vorhandenen Hügel geschüttet. Nach jeder Schüttung entstanden neue Proportionen der gehäuften Körper und veränderten den Ort. Mit der Schüttung verband Kanitz die Absicht, durch permanente Hinzufügung einen Parallelprozess zum Brennen zu installieren, der von den Hinterlassenschaften des Brennvorganges genährt wird. Das Material der Hügel sollte sich so weit ausdehnen und verbreitern, dass sich am Ende eine Umformung durch die Vermischung aller angelegten Hügel zu einem einzigen ergeben wird. Gleichwohl werden in dieser von Zeit und Distanz bestimmten Anordnung weitere Prinzipien im Kunstschaffen von Kanitz erkennbar. Die Bedeutung der Verkettung im prozessualen Tun, Gewolltes steht neben Ungewolltem, das Eine entsteht, und das Andere entsteht für eine weitere Transferierung. Wobei das Finden nie von einer Suche geleitet wird, vorgefunden und gefunden ist dasjenige, was da ist und sich in den Weg stellt.
Eine zentrale Linie im Kunstschaffen von Kanitz sind die subtil arrangierten Versuchsanordnungen mit grobem Material, mit naturbelassenen Stücken aus dem Stamm von Eiche, Buche, Esche, Ulme, Ahorn, Linde. In der von Kanitz entwickelten TRANSFLORATION tritt die Radikalität und Systematik seiner speziellen Technik der Transformation am deutlichsten zutage. Bevor er beginnt, wird die Materialität des ausgewählten Holzstammes erkundet. Kanitz tritt mit dem Holz in ein Zwiegespräch und zeichnet mögliche plastische Formen, stellt Überlegungen an, macht Pläne für die Arten der Vorbereitung und der Intervention. Erst wenn ein schlüssiges Konzept für den Vorgang einer Transfloration vorliegt, in der sich eine Idee im Stadium des Imaginierens verbirgt, erst dann wird der Baum zum Material eines Brennvorganges. In dieser Phase gibt es neben dem Geheimniszustand ganz konkrete Maßnahmen am Material durchzuführen: Schnitte werden in das Holz gesetzt, Spaltungen, Ausschabungen, der Holzstamm wird quasi chirurgisch behandelt, wird vorbereitet und geöffnet. Für diesen Produktionsprozess braucht Kanitz einen speziell eingerichteten Raum, einen technischen Ort, der handwerkliche Behandlung und inszenierte Einwirkung gleichermaßen ermöglicht. Kanitz arbeitet mit schwerem Gerät, mit eisernen Gerüsten, Hebevorrichtungen, Ketten, mit kalkulierten Feuerungen, mit der Kettensäge um Material vorzubereiten, es anzuformen. Manchmal unterstützt er den Brennvorgang durch Flammen aus einem flexiblen Brenner, der das horizontal oder vertikal aufgehängte Stück gezielt von unterschiedlichen Seiten behandelt. Das entstandene gerußte Holzobjekt wird gebürstet, gewaschen und weiter ausgearbeitet zu einer Skulptur. Bizarre Ausbuchtungen, Durchlöcherungen, Verformungen gleichsam als Gebeine und Glieder machen aus diesen archaischen Baumskulpturen mythische Objekte aus einer anderen Zeit. Auch hier ist es der Kontext zum öffentlichen Raum, der Bezug zur Umgebung, zum Vergleich mit dem, was vorhanden ist, der die Baumskulptur erst vollendet zu einem Medium von Zeit und Raum. So stehen die Transflorationen manchmal für eine Art Zeitenwende, fügen sich ambivalent in das Vorhandene, trennen das Alte von dem Neuen, vereinen Abschied und Anfang. Gleichsam als Symbole einer natürlichen Welt blicken sie nach vorne und rückwärts zugleich.
Die Herkunft der tief schwarzholzigen BÜNDEL ist nicht leicht zu bestimmen noch zu erkennen. Sie sind zeremoniell verrätselt und Ergebnis einer radikalen und extrem konzeptionellen Bearbeitung des Künstlers. Ihre dicht nebeneinander liegenden vertikalen Stangen werden von der Geometrie eines kantigen Blocks bestimmt und darin eingezwängt. Man fragt sich, wie es möglich ist, die Strenge solcher Bündelungen aus nur einem Stück Holz hervorzubringen, und spürt die bezwingende Kraft dahinter. In weiteren, nicht theoretisch zu dechiffrierenden Vorgängen der Bearbeitung erschafft Kanitz aus der Bündelskulptur noch andere plastische Formen:
Im Relief wird das Regelwerk des Bündels gleichsam als kreisförmiger Aufriss gezeigt und ausgebreitet. Ein fächerartiges Volumen entsteht im Bündelrad. Man darf gespannt sein, in welche plastischen Formen Kanitz das Prinzip des Bündels noch treiben wird und vor allem, wo sie dann zu finden sind. Im Ziegeleipark Mildenberg befindet sich seit 2000 das OFFENE BÜNDEL. Wie eine vielfach aufgeschnittene Schienenschwelle steht diese Skulptur aufrecht zwischen zwei diametral verlaufenden Geleisen und akzentuiert eine seltsam historisierende Beziehung zu der brachliegenden Bahntechnik.
Alles soll aus einem Stück sein, nicht montiert, verschraubt oder gefügt. Ich setze nicht zusammen, sagt Kanitz, noch nicht. So kann ich in die Tiefe gehen, intensiver mit dem Material arbeiten. Alles gehört den Jahreszeiten an, ist Kommen und Gehen. Das Eigenleben soll aus der Substanz selbst bestimmt werden, darin liegt meine Wurzel. Immer wenn ich den Hauptweg verlassen habe, um etwas Anderes zu probieren, zu erforschen, bin ich auf diesen wieder zurückgekehrt. Zurückkehren, das heißt, ich bin nicht zurückgegangen, sondern habe mich wieder eingefädelt, an einer Stelle, die weiter vorne liegt, an einem neuen Ort. Meine stärkste Verbindung habe ich zum Holz, zum Baum, zur Pflanze, zur Landschaft und zu meiner Kindheit. Das Abgehen vom Weg Material ist nicht mutwillig, nicht bewusst – es geschieht, weil mich manchmal Substanzen interessieren, die woanders liegen.
Im Atelier von Kanitz stehen neben dem abgedeckten Billardtisch viele kleine und große Tische. An der Wand gegenüber dem Fenster befindet sich ein verwitterter Arbeitstisch mit Handwerksgeräten: Motorsäge, Schleifmaschine, Bandschleifer, Axt, Spalthammer, große und kleine Keile, Bürsten. Auf dem kleinen Tisch am Fenster liegen Federn, Bleistifte und dünne Pinsel, Radiernadeln, Skalpelle, Zirkel, Anspitzmaschinen und die Schleifsteine für die Bildhauereisen.
Auch in den Arbeiten mit PAPIER stecken die für Kanitz typischen Überlagerungen von künstlicher und natürlicher Behandlung. Im messerscharfen Führen der Flamme zum Linienziehen werden Kreise in Papier geglüht. Im zeichnerischen Glimmvorgang entstehen Linie und Öffnung gleichzeitig. Kanitz schichtet die so erreichten Papiere aufund gegeneinander zu minimal gestuften, reliefartigen Bildern um. In konzentrischen Kreisen liegen die Glühlinien dicht nebeneinander und zeigen eine Andeutung von Tiefe. Bei einigen Arbeiten überzieht grauweiße Asche gleichsam als eine fein aufgetragene Puderschicht die Haut des Papiers. Es ist die eigene Asche des Papiers, in genau der Konsistenz, wie sie durch den Glühvorgang erzeugt wurde.
In den Jahren von 1998 bis 2000 arbeitete Kanitz schwerpunktmäßig an der Entwicklung seiner Transfloration in dem rund 200 Einwohner zählenden Dorf Netzeband, das sich etwa 80 km nordwestlich von Berlin im Ruppiner Land befindet. In einem verlassenen Wohnhaus auf der ehemaligen Tagelöhnerseite der Dorfstraße richtete er damals eine Galerie ein. KUNST stand in roten Buchstaben auf der abgeblätterten Grauwand. In der einstigen Wohnstube stellte er Objekte und Bilder aus. Nicht nur seine eigenen, sondern auch die von befreundeten Künstlern. Aus dieser Zeit stammen die HERBARIEN. Das sind doppelseitige Blätter mit gepressten Pflanzen, Gräsern, Blüten aus den Jahren 1932 bis 34. Zu den dünnhäutig gewordenen floralen Stücken hat Kanitz in grafischen Zeichen und verschlüsselten Figuren fein strukturierte Informationen und Momente aus unserer Zeit mit Eisenchlorid, Sprühlack, Tusche hinzugefügt. Die Herbarien sind eigenartige räumliche Bilder, Archive in der Matrix einer Bildlichkeit, in denen das nur noch als ein Hauch vorhandene Vergangene und das dünn aufgetragene Gegenwärtige nebeneinander stehen und sich dann je nach Blickwinkel, Lichteinfall und Aufmerksamkeitsgrad überlagern.
Das jüngste Werk von Jens Kanitz ist Bestandteil des Skulpturenpfades 2005 in der Stadt Neuruppin. Es ist eine Auftragsarbeit, die ihre Konzeption vom zugewiesenen Ort erfuhr. Direkt in der Nähe zum Amtsgericht Neuruppin steht AXIS MUNDI, eine 7,10 m hohe Holzskulptur, deren Stamm umgürtet wird von fünf gleichgroßen orangefarbenen Kugeln und einer weißen im unteren Teil. Auf Augenhöhe positioniert zeigt der weiße Kugelkörper seine Kerben, Furchen, Risse und spricht von der Beweglichkeit seines Materials. Es ist sicher kein Zufall, dass Kanitz gerade diese Kugel so gesetzt hat, dass sie ganz aus der Nähe betrachtet und umgangen werden kann, denn nur dann offenbart sich der so scheinbar glatte Holzkörper als ein Meer von unendlich kleinen und großen Verfaltungen, von Unregelmäßigkeiten. Doch strahlt das Holz auch Ruhe und Gelassenheit aus – genauso wie alle anderen Kugeln darüber, hebt man nur den Blick in die Höhe. Mit mehr Abstand konstatiert man die Frohnatur der Achse. Ortsfest aufgerichtet steht sie mit ihren kugelförmigen Körperteilen direkt an der Straßenecke, und in Augenblicken wirkt sie wie eine leicht schwankende Gerade inmitten eines Systems von Gebautem. Frappant ist, wie AXIS MUNDI aus der siebten Kugel hervorkommt, die in der Erde verschwunden nur mit ihrem obersten Segment aus dem Boden lugt. An dieser Stelle erfährt der Betrachter etwas vom Zustand des Werdens, vom Hervorkommen aber auch von der Möglichkeit des Steckenbleibens. Mit dieser in den Stadtraum implantierten Skulptur offenbart sich Kanitz einmal mehr als Ideenkünstler mit dem Mut zu ambivalenten Sprachen und zu riskanten Konstruktionen. Wie sonst ist es denn möglich, wenn man nicht beide Wege begeht, mitten in Neuruppin, im flutenden Verkehr ein Bild zu pflanzen, das von einer in die Erde verschwindenden Weltachse erzählt, von der wir nicht wissen, wo sie endet oder wo sie anfängt.
Eine Konstante im Werk von Jens Kanitz ist das Prozessuale in der Umwandlung und Umgestaltung von vorgefundenem Material. Eine besondere Rolle dabei spielt sein Denken und Sehen, dass auf Entsicherung des Wahrgenommenen zielt und eher die Umkehrung der Verhältnisse sucht als ihre Verdoppelung. Für Kanitz sind Natur und Landschaft mit der Intention ausgestattet, gesehen und gehört zu werden. Erst durch einen solchen Bezug zur Wirklichkeit wird es möglich, neue und andere Intensitätsfelder der Auseinandersetzung zu erschließen und in künstlerische Prozesse zu überführen.